TRbF 50: Rohrleitungen
| (BArbBl. 6/2002 S. 69) |
(BArbBl. 6/2002 S. 69)
Vorbemerkung
Die Europäische Union kann zur Beseitigung von Handelshemmnissen Richtlinien nach Artikel 95 des EG-Vertrages erlassen, die Beschaffenheitsanforderungen an Anlagen und Anlagenteile enthalten, über die nicht hinausgegangen werden darf (sog. "harmonisierter Bereich"). Um der EG-Kommission die Beseitigung von Handelshemmnissen im "nicht harmonisierten Bereich" zu ermöglichen, sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgrund der EG-Informationsrichtlinie 83/189/EWG verpflichtet, der Kommission ihre nationalen technischen Bestimmungen, die Beschaffenheitsanforderungen enthalten, zu übermitteln (Notifizierungsverfahren). Die anderen Mitgliedstaaten können zu diesen Spezifikationen und Vorschriften Stellungnahmen einreichen. Die Mitgliedstaaten dürfen jedoch weiterhin Anforderungen zum sicheren Betrieb von Anlagen stellen. Soweit, hierzu in Richtlinien nach Artikel 137 (Arbeitsschutzkomponente des EG-Vertrages) Mindestanforderungen gestellt werden, dürfen diese nicht unterschritten werden.
Vor diesem Hintergrund hat der DAbF die Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten "Rohrleitungen innerhalb des Werksgeländes einschließlich Rohrleitungen zur Versorgung von Ölfeuerungsanlagen" (TRbF 131 Teil 1/231 Teil 1) überarbeitet und aktualisiert. Der neuen TRbF 50 "Rohrleitungen" liegen neben den Betriebsvorschriften der TRbF 131 Teil 1 (Fassung 06.97) und TRbF 231 Teil 1 (Fassung 06.97) auch die für Rohrleitungen maßgebenden Betriebsvorschriften der TRbF 100, 180, 200 und 280 zugrunde.
Die neue TRbF 50 beinhaltet Anforderungen an Rohrleitungen zur Beförderung brennbarer Flüssigkeiten aller Gefahrklassen. Im allgemeinen werden dabei zuerst die Anforderungen an Rohrleitungen zur Beförderung brennbarer Flüssigkeiten aufgeführt, die für brennbare Flüssigkeiten aller Gefahrklassen gemeinsam gelten. Daran anschließend folgen additiv die Anforderungen, die nur für Rohrleitungen zur Beförderung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen A 1, A II und B gelten.
Der Anhang A der TRbF 50 enthält die (bereits notifizierten) relevanten Beschaffenheitsanforderungen der alten TRbF 131 Teil 1 und 231 Teil 1.
Der Anhang B der TRbF 50 enthält die für Schlauchleitungen relevanten Beschaffenheitsanforderungen sowie die Betriebsanforderungen aus der TRbF 131 Teil 2.
Die Beschaffenheitsanforderungen des Anhangs sollen durch noch zu erarbeitende europäische harmonisierte Normen ersetzt werden.
Um die TRbF 50 ohne die Gefahr anderslautender Formulierungen zu anderen TRbF in sich geschlossen verständlich zu machen wurden einige Formulierungen als Zitat aus den TRbF 20 und 30 übernommen und entsprechend gekennzeichnet.
Geltungsbereich
Diese Technische Regel enthält Anforderungen an Montage, Installation und Betrieb von
für brennbare Flüssigkeiten aller Gefahrklassen.
Diese Technische Regel gilt nicht für Fernleitungen für brennbare Flüssigkeiten aller Gefahrklassen.
Für die Beschaffenheitsanforderungen der Rohrleitung gilt der Anhang.
Auf die Bestimmungen aus anderen Rechtsgebieten, insbesondere der landesrechtlichen Verordnungen über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe zum Schutz der Gewässer, wird hingewiesen.
1 Allgemeines
(1) Rohrleitungen zur Beförderung brennbarer Flüssigkeiten müssen so installiert, montiert und ausgerüstet sein sowie so unterhalten und betrieben werden, dass die Sicherheit Beschäftigter und Dritter, insbesondere vor Brand- und - bei der Beförderung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse A I A II und B sowie brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III, die auf ihren Flammpunkt oder darüber erwärmt sind - zusätzlich vor Explosionsgefahren, gewährleistet ist.
(2) Die hierfür erforderlichen Maßnahmen sind abhängig von
1. dem Förderdruck der brennbaren Flüssigkeit,
2. den Eigenschaften, insbesondere der Gefahrklasse, der beförderten brennbaren Flüssigkeit.
(3) Absatz 1 gilt insbesondere als erfüllt, wenn
2 Begriffe
(1) Rohrleitungen innerhalb des Werksgeländes sind feste oder flexible Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten und deren Dämpfe. Dazu zählen auch Rohrleitungen, die Anlagen verbinden, die in engem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang miteinander stehen und kurzräumig durch landgebundene öffentliche Verkehrswege getrennt sind1).
(2) Zu den Rohrleitungen gehören außer den Rohren2), Formstücken und Armaturen auch die Pumpen, sofern sie nicht anderen Anlagen zugeordnet sind.
(3) Dämpfeführende Leitungen sind Lüftungsleitungen von Tanks sowie Rohrleitungen von Gaspendel- und Gasrückführeinrichtungen.
(4) Unterirdische Rohrleitungen sind Rohrleitungen, die vollständig oder teilweise im Erdreich oder vollständig in Bauteilen, die unmittelbar mit dem Erdreich in Berührung stehen, verlegt sind. Alle übrigen Rohrleitungen sind oberirdische Rohrleitungen.
(5) Drucklos betriebene Rohrleitungen sind Rohrleitungen, die nur durch den Druck einer Flüssigkeitssäule des Beschickungsgutes beansprucht sind, sofern kein zusätzlicher Druck von mehr als 0,1 bar aufgebaut wird.
(6) Werksgelände im Sinne dieser TRbF sind die Grundstücke, die zu einem oder mehreren gewerblichen oder industriellen Betrieben gehören und deren Zwecken dienen. Das Werksgelände muss erkennbar von der Nachbarschaft, z.B. durch einen Zaun, abgetrennt sein und überwacht werden. Die Grundstücke mehrerer gewerblicher oder industrieller Betriebe können zu einem Werksgelände zusammengefasst werden, wenn die zusammengefassten Grundstücke zusammenhängend als Ganzes von der Nachbarschaft abgegrenzt sind und der Zutritt nur Befugten gestattet ist.
(7) Für die Zwecke dieser TRW werden die folgenden Rohrleitungsgruppen
festgelegt:
1) Zur Unterscheidung von den Fernleitungen wird auf §§ 19a und 19g
WHG verwiesen.
2
) Betriebsmäßig mit brennbaren Flüssigkeiten beaufschlagte unterirdisch verlegte Rücklaufleitungen an Heizölverbraucheranlagen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.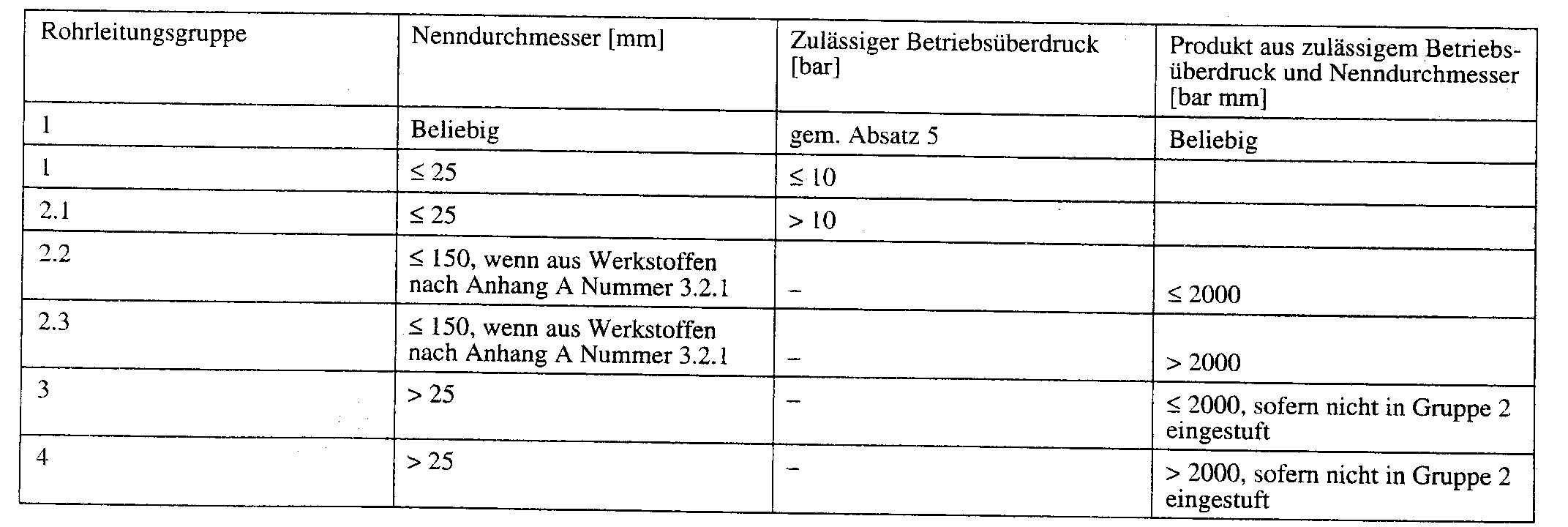
3 Allgemeine Anforderungen an Rohrleitungen
(1) Rohrleitungen müssen so montiert und installiert sein und betrieben werden, dass brennbare Flüssigkeiten aus ihnen nicht auslaufen können oder dass Undichtheiten schnell und zuverlässig feststellbar sind. Sie sind so anzuordnen, dass sie gegen nichtbeabsichtigte Beschädigung gesichert sind.
(2) Rohre aus metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen dürfen grundsätzlich als Bauprodukte nur verwendet werden, wenn für sie ein baurechtliches Übereinstimmungszeichen vorliegt.
(3) Nach den Vorschriften zum Schutz der Gewässer sind unterirdische Rohrleitungen nur zulässig, wenn sie
4 Bauvorschriften
4.1 Allgemeine Anforderungen
(1) Wandungen von Rohrleitungen müssen den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen standhalten und gegen die brennbaren Flüssigkeiten und deren Dämpfe undurchlässig (flüssigkeitsdicht) und beständig sein.
(2) Wandungen von Rohrleitungen müssen über Absatz 1 hinaus im erforderlichen Maße alterungsbeständig und gegen Flammeneinwirkung widerstandsfähig sein.
(3) Für Rohre oder Formstücke in Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A IH als Teil eines bauaufsichtlich zugelassenen Tanksystems aus nichtmetallischen Werkstoffen ist eine Widerstandsfähigkeit gegen Flammeneinwirkung nicht erforderlich.
(4) Rohrleitungen einschließlich ihrer Formstücke und Armaturen müssen unabhängig von ihrer Druckbeanspruchung mindestens für den Nenndruck PN 10 ausgelegt sein. Der Prüfüberdruck beträgt das 1,3fache des maximal zulässigen Druckes, jedoch mindestens 5 bar.
4.2 Besondere Anforderungen an Rohre aus metallischen Werkstoffen für geschweißte Rohrleitungen
(1) Werkstoffe für Rohre, die für geschweißte Rohrleitungen verwendet werden, müssen auch den an die Verarbeitung und Schweißeignung zu stellenden Anforderungen genügen.
(2) Absatz I gilt bei den Werkstoffen nach Nummer 3.21 Ziffer 1 bis 4 des Anhangs A als erfüllt.
5 Herstellung und Verlegung der Rohrleitungen
5.1 Allgemeines
5.1.1 Verlegung
(1) Beim Zusammenfügen einer Rohrleitung dürfen die einzelnen Rohre nicht unzulässig beansprucht oder verformt werden. Montageanweisungen sind zu beachten.
(2) Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn durch Kalt- oder Warmumformung, z.B. Richtarbeiten oder durch das Biegen der Rohre, die Güteeigenschaften des Werkstoffs nicht unzulässig beeinträchtigt und die einzelnen Rohre so zusammengefügt worden sind, dass Spannungen und Verformungen, die die Sicherheit der Rohrleitung beeinträchtigen können, ausgeschlossen sind.
(3) Rohrleitungen in schwingungsgefährdeten Anlagen - z.B. bei Anschluss an Pumpen - müssen durch entsprechende Maßnahmen so ausgeführt sein, dass Undichtheiten durch Schwingungsbeanspruchungen nicht zu befürchten sind.
(4) Als Grundsätze für die Kalt- und Warmumformung und die Wärmebehandlung gelten z.B. die AD-Merkblätter der Reihe HP oder prEN 13480-4.
(5) Insbesondere bei Schneid- und Klemmringverschraubungen ist darauf zu achten, dass sie, z.B. durch geeignete Anordnung der Rohrhalterungen, in Bereichen geringer Beanspruchung eingesetzt werden.
5.1.2 Verbindung der Rohre
(1) Verbindungselemente zwischen einzelnen Rohren müssen so ausgeführt sein, dass eine sichere Verbindung und technische Dichtheit gewährleistet sind.
(2) Die Anzahl von lösbaren Verbindungen ist möglichst gering zu halten.
(3) Verbindungen zwischen Rohrleitungsteilen müssen längskraftschlüssig ausgeführt sein. Dies gilt als erfüllt, wenn z.B. Schweiß-, Hartlöt-, Schraubmuffen-, Schraub- oder Flanschverbindungen oder Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 oder DIN 3861 (DIN EN ISO 8434-1) verwendet werden.
(4) Lösbare Verbindungen, z.B. Flansch- und Schraubverbindungen sowie Schneidringverschraubungen, müssen in für Kontrollen gut zugänglichen Bereichen angeordnet sein. Schneidringverschraubungen dürfen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A II und B nur bis DN 32 und nur zur Verbindung von Präzisionsstahlrohren mit Abmessungen nach DIN 2391-1 und 2393-1, Edelstahlrohren mit Abmessungen nach DIN 2462 in den Toleranzklassen D 4 und T 4 sowie Kupferrohren mit Abmessungen nach DIN EN 1057 verwendet werden.
(5) Bei Schraubmuffen- und Schraubverbindungen wird bezüglich der Wanddicke auf DIN 2441 und bei lichten Weiten über DN 50 auch auf DIN 2440 hingewiesen.
(6) In Rohrleitungen zur Versorgung von Ölfeuerungsanlagen sind Verbindungen durch Hartlöten
(7) Im Zuge von Rohrleitungen zur Versorgung von Ölfeuerungsanlagen sind zwischen der Rohrleitung und einer Pumpe kurze Schläuche zulässig, wenn sie DIN EN ISO 6806 entsprechen und eine Schutzeinrichtung - z.B. Ölauffangschale mit Olmeldeeinrichtung - vorhanden ist. Die Schutzeinrichtung muss bei Ölaustritt die Förderpumpe abschalten.
(8) Auf die wasser- und baurechtlichen Anforderungen an den Nachweis der Eignung von Verbindungen, die nicht durch Schweißen oder Löten hergestellt sind, wird verwiesen.
5.1.3 Unzulässige Rohrverbindungen
(1) In Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten sind Steckmuffenverbindungen ohne Sicherungsschellen, Weichlotverbindungen und Verschraubungen unter Verwendung elastischer Bauteile, zur Abdichtung - sogenannte Quetschverschraubungen - nicht zulässig. Anlässlich von Wartungs- und Prüfarbeiten vorgefundene Quetschverschraubungen sind gegen zulässige Verbindungen, z.B. Schneidringverschraubungen, auszutauschen.
(2) In Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten, die nicht oder teilweise nicht einsehbar verlegt sind, sind lösbare Verbindungen nicht zulässig. Dies gilt nicht für unterirdische Saugleitungen.
(3) Absatz 1 und 2 gelten nicht für dämpfeführende Leitungen.
5.2 Grundsätze für Schweißarbeiten
5.2.1 Allgemeines
Die Schweißnähte an Rohrleitungen müssen unter Verwendung geeigneter Arbeitsmittel und Zusatzwerkstoffe sowie nach sorgfältiger Vorbereitung der Rohrenden so ausgeführt sein, dass eine einwandfreie Verschweißung gewährleistet ist und Eigenspannungen auf das Mindestmaß begrenzt bleiben.
5.2.2 Befähigung zum Schweißen
(1) Bei der Montage und Installation von geschweißten Rohrleitungen sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller nachweislich beherrscht werden und welche die Gleichmäßigkeit der Schweißnähte gewährleisten.
(2) Die Montage- und Installationsbetriebe dürfen nur nach DIN EN 287-1 geprüfte Schweißer einsetzen. Sie müssen über sachkundiges Aufsichtspersonal verfügen.
(3) Für den Nachweis der Befähigung zum Schweißen gilt die Tabelle x.
Tabelle x: Erforderliche Nachweise der Befähigung zum Schweißen
|
Rohrleitungs- gruppen |
Schweißernachweis |
Befähigung zum Schweißen |
|
1 |
Schweißerzeugnis nach DIN EN 287-1 |
Schweißerzeugnis nach DIN EN 287-1 |
|
2 |
Schweißerprüfung nach AD HP 3 |
Objektgebundene Arbeitsprüfung |
|
3 |
Schweißerprüfung nach AD HP 3 |
Verfahrensprüfung in Anlehnung an AD-HP 2/13) |
|
4 |
Schweißerprüfung nach AD HP 3 |
Verfahrensprüfung nach AD-HP 2/1 |
3
)Hersteller oder Errichtet müssen sich durch Prüfungen vergewissern, dass die Qualifikation von Verfahren und Schweißer vorhanden ist(4) Für die Schweißaufsicht gilt AD-Merkblatt HP 3. Entsprechende Nachweise sind dem Sachverständigen zu erbringen.
5.2.3 Schweißzusatz- und Hilfsstoffe
(1) Die Schweißzusätze, ggf. in Kombination mit Schweißhilfsstoffen, müssen für die Herstellung von Rohrleitungen geeignet sein, d.h. das Schweißgut muss auf die Grundwerkstoffe abgestimmt und die hierfür erforderlichen Güteeigenschaften müssen z.B. in einer Schweißzusatzspezifikation festgelegt sein.
(2) Für die Qualifikation der Schweißzusatz- und -hilfsstoffe gilt Tabelle z.
Tabelle 2: Erforderliche Eignungsnachweise für Schweißzusatz- und -hilfsstoffe
|
Feststellung der Eignung |
Rohrleitungsgruppe |
|
durch Hersteller |
1, 2.1, 2.2, 3 |
|
gem. VdTÜV-Mbl. 1153 |
2.3, 4 |
5.2.4 Ausführung der Schweißnähte
(1) Die Schweißnähte müssen über den ganzen Querschnitt durchgeschweißt sein. Sie dürfen keine Risse und keine unzulässigen Bindefehler und Schlackeneinschlüsse aufweisen. Für Rohrleitungen der Gruppen 2.2, 2.3, 3 und 4 wird auf TRR 100 verwiesen.
(2) Bei Anwendung der Schmelzschweißung sollen die Schweißnähte mehrmalig ausgeführt sein.
(3) Die Verbindungsnähte zwischen Rohren sowie zwischen Rohren und Formstücken müssen als Stumpfnähte ohne wesentlichen Kantenversatz ausgeführt werden.
5.2.5 Zerstörungsfreie Prüfung der Schweißverbindungen
Für den Umfang der zerstörungsfreien Prüfung (Röntgen oder US-Prüfung) der Schweißverbindungen gilt Tabelle y.
Tabelle y: Erforderlicher Umfang der zerstörungsfreien Prüfung der Schweißverbindungen
|
Rohrleitungsgruppe |
Erforderlicher Umfang in % der Rundnähte |
|
1, falls DN > 100 aus Stählen der Sorte 52.0 oder WTSt52-3 oder Stählen nach DIN 17172 der Sorten StE 360.7 bis StE 480.7 TM , 2.1 |
2 |
|
2.2 und 3, Werkstoffgruppen 1, 5.1, 6 und All gern. AD-HP 0 |
2 |
|
2.2 und 3, Werkstoffgruppen 2, 4.1, 5.2, 5.4, 7 und A12 gern. AD-HP 0 |
10 |
|
2.2 und 3, Werkstoffgruppen 3, 4.2, 5.3 und Cu gern. AD-HP 0 |
25 |
|
2.3 und 4, Werkstoffgruppen 1, 5.1, 6 und All gern. AD-HP 0 |
10 |
|
2.3 und 4, Werkstoffgruppen 2, 4.1, 5.2, 5.4, 7 und A12 gern. AD-HP 0 |
25 |
|
2.3 und 4, Werkstoffgruppen 1, 5.1, 6 und All gern. AD; HP 0 |
100 |
5.3 Grundsätze für Lötarbeiten
5.3.1 Allgemeines
Lötverbindungen in Rohrleitungen müssen unter Verwendung geeigneter Arbeitsmittel als Hartlötverbindungen durch Spaltlötung (Kapillarlötung) so ausgeführt und hergestellt werden, dass eine einwandfreie Lötung gewährleistet ist. Lötverbindungen sind zulässig bis DN 32.
5.3.2 Befähigung zur Lötung
Hersteller oder Errichter müssen sich durch Prüfungen vergewissern, dass die Qualifikation von Verfahren und der Löter vorhanden ist.
5.3.3 Lötzusatz- und Hilfsstoffe
Für Lötzusatz- und Hilfsstoffe wird auf das DVGW-Arbeitsblatt GW 2 verwiesen.
5.3.4 Ausführung der Lötarbeiten
Der Benetzungsgrad der Lötverbindung muss mindestens 80 % der Mindest-Überlappungslänge, die Mindest-Überlappungslänge muss das 3fache der Wanddicke, mindestens aber 5 mm betragen.
5.3.5 Prüfung der Lötverbindung
Der Umfang der zerstörungsfreien Prüfung (Röntgen- oder Ultraschallprüfung) beträgt 2 % der Lötverbindungen. Die 2 %ige Prüfung kann nicht-objektgebunden erfolgen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass alle Löter erfasst werden. Flächenhafte Fehler sind mittels zweier um 90° versetzter Aufnahmen am fertigen Bauteil feststellbar, so dass der Spaltfüllungsgrad (Benetzungsgrad) feststellbar ist. Alternativ zu diesen zerstörungsfreien Prüfungen können auch Arbeitsprüfungen im vergleichbaren Umfang objektgebunden im Labor zerstörend oder zerstörungsfrei geprüft werden. Art der zerstörungsfreien Prüfung und Beurteilung der Prüfbefunde erfolgt in Anlehnung an AD-Merkblatt HP 5/3.
5.4 Verlegung der Rohrleitungen
5.4.1 Allgemeines
(1) Rohrleitungen sind grundsätzlich oberirdisch und außerhalb der Verkehrsbereiche zu verlegen und müssen leicht zugänglich sein. Es sollen möglichst wenig lösbare Verbindungen verwendet werden.
(2) Oberirdische und unterirdische Rohrleitungen müssen so verlegt sein, dass sie gegen mögliche Beschädigungen geschützt sind.
(3) Absatz 2 gilt für unterirdische Rohrleitungen z.B. als erfüllt, wenn sie durch Abdecksteine oder eine befestigte Fahrbahn geschützt oder mit mindestens 60 cm Erddeckung verlegt sind.
(4) Schutzrohre sind nur für Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III zulässig. Die Schutzrohre müssen ausreichend fest, flüssigkeitsdicht und gegen Korrosion beständig oder geschützt sein. Die Eignung ist nachzuweisen. Geeignet sind z.B. Kunststoffrohre aus PE-Hart nach DIN 19 533 oder aus PVC-Hart nach DIN EN 1452-1 bis -5.
5.4.2 Unzulässige Lageveränderung
(1) Rohrleitungen müssen unter Berücksichtigung der üblicherweise auftretenden Dehnungen so verlegt sein, dass sie ihre Lage nicht unzulässig verändern.
(2) Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn
1. temperaturbedingte Dehnungen bei der Verlegung berücksichtigt und längere Rohrleitungen mit elastischen Zwischenstücken ausgerüstet sind, soweit nicht die Rohrführung ausreichende Dehnung ermöglicht. Zur Elastizitätskontrolle siehe TRR 100 Nummer 6.2.3,
2. oberirdische Rohrleitungen auf Stützen in ausreichender Anzahl aufliegen, so dass eine unzulässige Durchbiegung vermieden wird, und sie so befestigt sind, dass gefährliche Lageveränderungen nicht eintreten können. Zu der Festlegung der zulässigen Stützweiten siehe TRR 100 Nummer 6.2.2, und
3. unterirdische Rohrleitungen in Rohrgräben oder -kanälen so verlegt sind, dass sie gleichmäßig aufliegen.
5.4.3 Schutz der Umhüllung
(1) Unterirdische Rohrleitungen müssen so verlegt sein, dass die Unversehrtheit der ggf. vorhandenen Umhüllung nicht beeinträchtigt ist.
(2) Absatz 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn für die Vorbereitung der Sohle und zum Verfüllen der Rohrgräben oder -kanäle Sand (Korngröße ≤ 2 mm) oder andere Bodenstoffe verwendet worden sind, die frei von scharfkantigen Gegenständen, Steinen, Asche, Schlacke und anderen bodenfremden und aggressiven Stoffen sind. Sie müssen damit allseitig in einer Schichtdicke von mindestens 10 cm umgeben sein.
(3) Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklassen A 1, A 11 und B, die unter Erdgleiche außerhalb von Gebäuden oder in Rohrkanälen verlegt sind, müssen vollständig vom Verfüllmaterial umgeben sein. Es dürfen keine Hohlräume vorhanden sein.
(4) Abweichend von Absatz 3 brauchen Rohrleitungen in Kanälen, die oben offen sind oder mit Gitterrosten abgedeckt sind, oder bei denen der Explosionsschutz auf andere Weise gewährleistet wird, nicht vom Verfüllmaterial umgeben zu sein.
5.4.4 Füll- und Entleerungsleitungen
Unterirdische Füll- und Entleerungsleitungen sollen mit stetigem Gefälle zum Tank verlegt sein.
5.4.5 Abstand unterirdischer Rohrleitungen
(1) Unterirdische Rohrleitungen müssen so verlegt sein, dass ein Abstand von mindestens 1 m zu öffentlichen Versorgungsleitungen vorhanden oder die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.
(2) Zu den öffentlichen Versorgungsleitungen nach Absatz 1 gehören insbesondere Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen, elektrische Leitungen und Leitungen von Fernmeldeanlagen.
(3) Auf die Einhaltung des Mindestabstandes nach Absatz 1 kann im Einverständnis mit den zuständigen Stellen nur verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass durch geeignete Maßnahmen eine Gefährdung der Leitungen ausgeschlossen ist.
(4) Bei Kreuzungen mit Verkehrswegen sind die Auflagen der Verkehrslastträger zu beachten.
5.4.6 Anordnung von Armaturen
Armaturen müssen so angeordnet sein, dass sie gegen Beschädigung geschützt sind. Absperreinrichtungen sollen gut zugänglich und leicht zu bedienen sein.
6 Explosionsgefährdete Bereiche
6.1 Allgemeines
6.1.1 Anwendungsbereich
Explosionsgefährdete Bereiche werden nachstehend für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A I, A II und B sowie brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III, die auf ihren Flammpunkt oder darüber erwärmt werden, festgelegt. Für brennbare Flüssigkeiten, die nicht unter die VbF fallen, wird auf BGR 104 "Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit - Explosionsschutz-Regem" (bisher ZH 1/10) verwiesen.
6.1.2 Begriffe
(1) Explosionsfähige Atmosphäre im Sinne der VbF ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch überträgt.
(2) Explosionsgefährdete Bereiche sind Bereiche, in denen explosionsfähige Atmosphäre durch Dampf/Luft-Gemische in solchen Mengen auftreten kann, dass besondere Schutzmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Schutzes von Sicherheit und Gesundheit der betroffenen Arbeitnehmer erforderlich werden. Die explosionsgefährdeten Bereiche werden nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens von explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen unterteilt.
(3) Zone 0: Bereiche, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einem Gemisch von Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln besteht, ständig, langzeitig oder häufig vorhanden ist.
(4) Zone 1: Bereiche, in denen damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln gelegentlich auftritt.
(5) Zone 2: Bereiche, in denen nicht damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln auftritt, aber wenn sie dennoch auftritt, dann aller Wahrscheinlichkeit nur selten und während eines kurzen Zeitraums.
(6) Zone 0 kann z.B. das Innere von Apparaturen und Rohrleitungen sein.
(7) Zone 1 kann z.B. sein
1. die nähere Umgebung der Zone 0
2. die nähere Umgebung von Beschickungsöffnungen,
3. der nähere Bereich um Füll- und Entleerungseinrichtungen
4. der nähere Bereich um Verbindungen, die betriebsmäßig gelöst werden,
5. der nähere Bereich um Stoptbuchsen, z.B. an Pumpen
6. die unmittelbare Nähe der Austrittsöffnungen von Entlüftungsleitungen.
(8) Zone 2 können z. B. sein
1. Bereiche, welche die Zonen 0 und 1 umgeben,
2. Bereiche um lösbare Verbindungen von Rohrleitungen.
6.1.3 Einteilung von explosionsgefährdeten Bereichen in Zonen
(1) Die Einteilung von Anlagen und Anlagenteilen in Zonen dient als Grundlage für die Beurteilung des Umfangs von Schutzmaßnahmen.
(2) Von den in Nummer 6 genannten Bereichen dürfen abweichende Zonen zugeordnet werden, wenn im Explosionsschutzdokument eine ausreichende Begründung4) hierfür erbracht wird.
(3) Explosionsgefährdete Bereiche können z.B. durch
1. besondere konstruktive Maßnahmen oder
2. besondere betriebliche Maßnahmen, z.B. technische Lüftung eingeschränkt werden.
6.2 Explosionsgefährdete Bereiche in und um Rohrleitungen und Armaturen (Übernahme aus TRbF 30)
(1) Das Innere von Rohrleitungen und Armaturen, die betrieblich nicht ständig mit Flüssigkeit gefüllt bleiben, ist explosionsgefährdeter Bereich. In der Regel werden diese Bereiche in die gleiche Zone eingestuft wie das Innere der angeschlossenen Behälter.
(2) Explosionsfähige Atmosphäre in der Umgebung von Rohrleitungen, Armaturen und Anlagenteilen kann durch deren Dichtheit vermieden werden. Hier wird unterschieden in
- auf Dauer technisch dicht und
- technisch dicht.
(3) Auf Dauer technisch dicht sind Rohrleitungen und Armaturen, wenn
- sie so ausgeführt werden, dass sie aufgrund ihrer Konstruktion technisch dicht bleiben oder
- ihre technische Dichtheit durch Instandhaltung und Überwachung gewährleistet wird.
Auf TRB 600 Nummer 5 und BGR 104 "Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit - Explosionsschutz-Regeln" (bisher ZH 1/10) Abschnitt E.1.3.2.1. wird verwiesen.
(4) Technisch dicht sind Rohrleitungen und Armaturen, wenn bei einer für den Anwendungsfall geeigneten Dichtheitsprüfung oder Dichtheitsüberwachung bzw. -kontrolle eine unzulässige Undichtheit nicht festgestellt wird. Auf TRB 600 Nummer 5 und BGR 104 "Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit - Explosionsschutz Regeln" (bisher ZH 1/10) Abschnitt E 1.3.2.2 wird verwiesen.
(5) Rohrleitungen und Armaturen, die nach Absatz 3 auf Dauer technisch dicht sind, und die Rohrleitungen und Armaturen, die nach Absatz 4 technisch dicht sind, sind nach TRB 700 Nummer 5.4 bzw. EXRL Abschnitt E 1.3.3 auf Dichtheit zu prüfen.
(6) Um technisch dichte lösbare Verbindungen von Rohrleitungen, die betriebsmäßig nicht oder nur selten gelöst werden, sowie um technisch dichte Armaturen in Räumen ist ein Bereich von 1 m horizontal um die Verbindung bis zum Boden Zone z. Im Freien wird kein explosionsgefährdeter Bereich festgelegt.
(7) Abweichend von Absatz 6 entfallen um Verbindungen von Rohrleitungen, die auf Dauer technisch dicht sind, die explosionsgefährdeten -Bereiche.
(8) Um Rohrleitungs- und/oder Schlauchanschlussstellen im Freien ist ein Bereich bis zu einem von jeder Kupplungshälfte gemessenen Abstand Ra nach Diagramm 1 Zone 1. Der Bereich reicht bei flüssigkeitsführenden Leitungen/Schläuchen nach unten bis zum Boden.
(9) Um Rohrleitungs- und/oder Schlauchanschlussstellen in Räumen mit mindestens 2-fachem Luftwechsel pro Stunde ist ein Bereich bis zu einem von der Verbindung gemessenen Abstand 2Ra nach Diagramm 1 Zone 1. Der Bereich reicht bei flüssigkeitsführenden Leitungen/Schläuchen nach unten bis zum Boden. Daran schließt sich ein Bereich bis zu einem horizontalen Abstand von 2Ra um die Zone 1 bis zu einer Höhe von 0,8 m über Erdgleiche als Zone 2 an.
4
) Auf die Richtlinie 1999/92/EG und die BGR 104 Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit-Explosionsschutz-Regeln (EX-RL) des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften wird verwiesen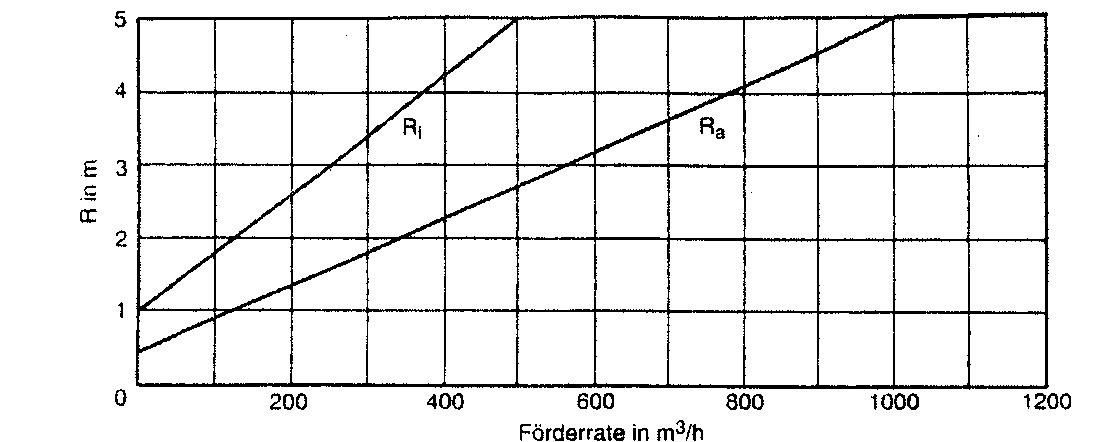
Diagramm 1: Abstände Ra und Ri
(10) Der explosionsgefährdete Bereich nach Absatz 8 und 9 gilt sowohl für gekuppelte als auch für getrennte Kupplungshälften. Der explosionsgefährdete Bereich um die Kupplungshälften nach Absatz 8 und 9 erstreckt sich über den gesamten Bereich, der während des Hantierens von den Kupplungshälften überstrichen werden kann.
(11) Abweichend von Absatz 10 ist aufgrund der Konstruktion der Rohrleitungs- und/oder Schlauchanschlussarmaturen, die im getrennten Zustand technisch dicht sind und nur eine geringe Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder deren Dämpfe ermöglichen (z. B. Trockenkupplungen), bis zu einem Abstand von 0,5 m um die Kupplungshälften Zone z. Der Bereich reicht bei flüssigkeitsführenden Leitungen/Schläuchen nach unten bis zum Boden.
(12) Um dicht verschlossene Rohrleitungs- und/oder Schlauchanschlussstellen (z. B. Blindflansch, Deckel) entfallen explosionsgefährdete Bereiche.
6.3 Explosionsgefährdete Bereiche in und um Pumpen (Übernahme aus TRbF 30)
(1) Um Pumpen, die auf Dauer technisch dicht sind (z.B. Pumpen mit Magnetkupplung), entfallen explosionsgefährdete Bereiche. Um alle anderen Pumpen ist ein explosionsgefährdeter Bereich nach Absatz 2 bis 7 vorzusehen.
(2) Um Pumpen im Freien ist ein Bereich bis zu einem von der Pumpengehäusewand gemessenen Abstand Ra nach Diagramm 1 Zone 1. Der Bereich reicht nach unten bis zum Boden. Ist der Kühlluftstrom des Antriebsmotors gegen die Pumpe gerichtet, ist abweichend von Satz 1 der Bereich um die Pumpe mit einem Abstand R, nach Diagramm 1 Zone 2.
(3) Das Innere von Pumpengruben ist Zone 1. Um die Pumpengrube ist ein Bereich bis zu einem Abstand von 2 m um die Öffnung bis zu einer Höhe von 0,8 m über Erdgleiche Zone 2, sofern er nicht nach Absatz 2 Zone 1 ist.
(4) Sind Pumpen, bei denen der Kühlluftstrom des Antriebsmotors gegen die Pumpe gerichtet ist, in Vertiefungen (Gruben) aufgestellt, die nicht tiefer als 1/10 der Grubenbreite und dabei nicht tiefer als 1,5 m sind, ist das Innere der Vertiefung (Grube) abweichend von Absatz 3 Zone 2.
(5) Um Pumpen in Räumen ohne besondere Lüftungsanforderungen ist ein Bereich bis zu einem von der Pumpengehäusewand aus gemessenen Abstand R; nach Diagramm 1 Zone 1. Darüber hinaus ist ein Bereich bis zu einem Abstand 2 R, Zone 2.
(6) Um Pumpen in Räumen mit besonderen Lüftungsanforderungen (z.B. 5-facher Luftwechsel) ist der Bereich um die Pumpe mit einem Abstand 2 R; nach Diagramm 1 nur Zone 2.
(7) In Bild 2 (Bild 10 der TRbF 20) ist ein Beispiel für explosionsgefährdete Bereiche um Pumpen dargestellt.
(8) Das Innere von Pumpen, die betrieblich nicht ständig mit Flüssigkeit gefüllt bleiben, ist explosionsgefährdeter Bereich. Nummer 6.2 Absatz 1 gilt entsprechend.
6.4 Explosionsgefährdete Bereiche in und an Kammern, Schächten und anderen Räumen
(1) Das Innere von Kammern, Schächten und anderen Räumen unter Erdgleiche, die
- in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1 oder Zone 2 oder in Wirkbereichen von Abgabeeinrichtungen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A II oder B liegen oder
- in denen durch Anlagen oder Anlagenteile explosionsfähige Gemische in gefahrdrohender Menge auftreten können
ist Zone 1.(2) Zu den Kammern gehören z.B. Schieberkammern, zu den Schächten z.B. Domschächte oder Kabelschächte, zu den Räumen z.B. Pumpenräume.
(3) Um Abdeckungen, Verschlüsse, Türen oder ähnliche Einrichtungen, die Öffnungen von Kammern, Schächten und anderen Räumen unter Erdgleiche nach Absatz 1 verschließen, ist ein Bereich in einem Umkreis von 0,5 m Zone 2.
(4) Absatz 3 gilt nicht für geschlossene, dicht abschließende Abdeckungen, Verschlüsse, Türen oder ähnliche Einrichtungen sowie für vergleichbare Abdeckungen von Domschächten unterirdischer Tanks. Hier entfällt die Zone 3.
(5) Um offene oder geöffnete Kammern, Schächte oder andere Räume unter Erdgleiche, die nach Absatz 1 Zone 1 sind, ist ein Bereich bis zu einem horizontalen Abstand von 2 m um die Öffnungen bis zu einer Höhe von 0,8 m über Erdgleiche Zone 2.
6.5 Schutzmaßnahmen und Lagerverbote in explosionsgefährdeten Bereichen
6.5.1 Schutzmaßnahmen vor Explosionsgefahren
(1) Es sind Maßnahmen zu treffen, die das Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre weitgehend ausschließen. Kann nach den örtlichen oder betrieblichen Verhältnissen das Auftreten solcher Atmosphäre nicht verhindert werden, so sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.
(2) Ergeben sich explosionsgefährdete Bereiche nach Nummer 6.2 bis 6.4, muss hierfür Gelände zur Verfügung stehen, auf dem die erforderlichen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden können.
(3) In den explosionsgefährdeten Bereichen sind Schutzmaßnahmen zu treffen, welche die Gefahr der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre verhindern oder einschränken oder die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken.
(4) In den explosionsgefährdeten Bereichen sind zu vermeiden
in Zone 2 betriebsmäßig zu erwartende Zündquellen (Zündquellen, die bei normalem, störungsfreiem Betrieb auftreten können),
in Zone 1 neben den für Zone 2 genannten Zündquellen auch Zündquellen durch Betriebsstörungen, mit denen man üblicherweise rechnen muss (häufiger auftretende Betriebsstörungen),
in Zone 0 neben den für Zone 1 genannten Zündquellen auch Zündquellen durch selten auftretende Betriebsstörungen.
(5) Betriebsmittel, Anlagen und Anlagenteile, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie die Anforderungen der Explosionsschutzverordnung vom 12. Dezember 1996 (BGBl. I, S. 1914) erfüllen, und nur in den Zonen, für die sie entsprechend der Zuordnung in Gerätegruppen und Gerätekategorien gemäß den Bestimmungen der Explosionsschutzverordnung geeignet sind. Geräte müssen danach in Abhängigkeit der betrieblich festzulegenden Zonen mindestens folgenden Kategorien entsprechen:
- Zone 0: Gerätegruppe II, Gerätekategorie 1 mit Kennzeichnung
- Zone 1: Gerätegruppe II, Gerätekategorie 2 mit Kennzeichnung "G..
- Zone 2: Gerätegruppe II, Gerätekategorie 3 mit Kennzeichnung "G".
(6) Abweichend von Absatz 5 dürfen in explosionsgefährdeten Bereichen auch Betriebsmittel, Anlagen und Anlagenteile einer anderen Gerätekategorie in Betrieb genommen werden, wenn das gleiche Sicherheitsniveau erreicht wird. Dies ist im Explosionsschutzdokument nachzuweisen und bedarf der Ausnahme nach § 6 VbF.
(7) Schutzsysteme, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie die Anforderungen der Explosionsschutzverordnung vom 12. Dezember 1996 (BGBl. I, S. 1914) erfüllen, und für den vorgesehenen Einsatzfall geeignet sind.
(8) In unmittelbarer Nähe von Zone 0 und Zone 1 und oberhalb aller explosionsgefährdeter Bereiche dürfen Zündquellen, die auf die explosionsgefährdeten Bereiche einwirken können, nicht betrieben werden. Unzulässig ist z.B.
1. die Unterhaltung von Feuerstätten,
2. der Umgang mit Feuer oder glühenden Gegenständen, mit offenem und verwahrtem Licht sowie das Rauchen.
(9) Die explosionsgefährdeten Bereiche sind von Stoffen freizuhalten, die ihrer Art oder Menge nach geeignet sind, zur Entstehung oder Ausbreitung von Bränden zu führen.
(l0) In explosionsgefährdeten Bereichen müssen Einmündungen und Schutzrohre für Kabel und Rohrleitungen gegen das Eindringen brennbarer Flüssigkeiten und deren Dämpfe geschützt sein.
6.5.2 Verbot der Lagerung in explosionsgefährdeten Bereichen
(1) Die explosionsgefährdeten Bereiche sind von Stoffen freizuhalten, die ihrer Art oder Menge nach geeignet sind, zur Entstehung oder Ausbreitung von Bränden zu führen. Unzulässig ist z.B. die Lagerung von explosionsfähigen Stoffen und Gegenständen mit explosionsfähigen Stoffen, von leichtentzündlichen und entzündend wirkenden Stoffen und der Umgang mit diesen Stoffen oder Gegenständen.
(2) Verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase dürfen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 nur unterirdisch gelagert werden. Dies gilt nicht für Brandschutzeinrichtungen.
7 Außenkorrosionsschutz
7.1 Allgemeines
Rohrleitungen, die korrosiven Einflüssen unterliegen und deren Werkstoffe nicht korrosionsbeständig sind, müssen gegen Korrosion geschützt sein.
7.2 Oberirdische Rohrleitungen
(1) Oberirdische Rohrleitungen, deren Werkstoffe nicht korrosionsbeständig sind, müssen mit einer geeigneten Beschichtung (Schutzanstrich) versehen sein.
(2) Im Auflagerbereich sind besondere Korrosionsschutzmaßnahmen zu treffen.
7.3 Unterirdische Rohrleitungen
(1) Unterirdische Rohrleitungen, deren Werkstoffe nicht korrosionsbeständig sind, müssen durch eine geeignete Umhüllung geschützt sein. Die Anforderung ist erfüllt, wenn z.B. Werksumhüllungen nach DIN 30 670, DIN 30 671 oder DIN 30 673 oder Baustellenumhüllungen nach DIN 30 672 verwendet werden.
(2) Ist ein mit einer unterirdisch verlegten Rohrleitung verbundener Tank mit einem kathodischen Korrosionsschutz ausgerüstet, ist auch die unterirdisch verlegte Rohrleitung kathodisch zu schützen oder elektrisch zu trennen.
(3) Werden Rohre oder Anlageteile aus unterschiedlichen Metallen, bei denen wegen einer galvanischen Elementbildung Korrosionen zu befürchten sind, miteinander verbunden, so müssen sie durch Isolierstücke voneinander elektrisch getrennt werden, sofern sie nicht kathodisch geschützt sind. Entsprechendes gilt für die Isolierung von Rohren gegen Halterungen.
(4) Am Übergang von unterirdischen zu oberirdischen Rohrleitungsabschnitten sind besondere Korrosionsschutzmaßnahmen wie z.B. Übergangsmanschetten (Pohl'scher Kragen) erforderlich.
8 Ausrüstung von Rohrleitungen
8.1 Allgemeines
Rohrleitungen müssen mit den für einen sicheren Betrieb erforderlichen Einrichtungen versehen sein.
8.2 Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung
(1) Rohrleitungen müssen gegen Drucküberschreitung gesichert sein, wenn eine Überschreitung des zulässigen Betriebsdrucks nicht auszuschließen ist.
(2) Die Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung müssen an geeigneter Stelle eingebaut werden und sind nach z.B. AD-Merkblatt A 2 auszulegen.
(3) Zur Verhinderung von unzulässigen Drücken infolge Erwärmung der brennbaren Flüssigkeit, z.B. durch Sonneneinstrahlung, dürfen z.B. Überströmventile verwendet werden.
(4) Die aus Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung austretenden brennbaren Flüssigkeiten müssen gefahrlos abgeleitet werden, z.B. in einen Leckflüssigkeitsbehälter.
(5) Sollen Rohrleitungen durch MSR-Einrichtungen gegen Drucküberschreitung abgesichert sein, sind die dafür geltenden Vorschriften und Regelwerke zu beachten.
8.3 Rohrleitungen zur Verbindung unmittelbar benachbarter Werksgelände
Bei Rohrleitungen, die Anlagen verbinden, die in engem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang miteinander stehen und kurzräumig durch landgebundene öffentliche Verkehrswege getrennt sind. (siehe Nummer 2 Absatz 1 Satz 2), ist die verbindende Rohrleitung z.B. über feste Bauwerke zu führen und durch zusätzliche Maßnahmen (z.B.
Rohrbrücke mit Auffangwanne und Spritzschutz, Doppelmantelleitung) der Schutz Beschäftigter und Dritter vor Gefahren durch die Anlage sicher zu stellen.8.4 Zusätzliche Anforderungen für genehmigungsbedürftige Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
Verbindungen und Abdichtungen an Pumpen, Armaturen und Rohrleitungen (Dichtungen) müssen so montiert, installiert und betrieben werden, dass sie während des Betriebes zur umgebenden Atmosphäre hin technisch dicht sind und die Dichtungen nicht aus ihrem Sitz gedrückt werden können. Die Auswahl eines anforderungsgerechten Dichtungssystems und der Werkstoffe muss unter Beachtung der zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen sowie der Beständigkeit gegenüber dem Fördermedium erfolgen. Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe gegenüber dem Medium kann z.B. durch die Betriebsbewährung von Referenzobjekten oder Resistenzlisten (z.B. Amtliche Bekanntmachungen, Verträglichkeit zwischen Füllgut und Werkstoff von Gefahrgutbehältern - Teil 15), DECHEMA-Werkstoff-Tabelle 6)beurteilt werden. Der Betreiber ist verpflichtet, durch Instandhaltung und Kontrolle die technische Dichtheit zu gewährleisten.
Für genehmigungsbedürftige Läger nach Nr. 9.2 des Anhanges zur 4. BImSchV mit
- mehr als 5 000 Tonnen Mineralölerzeugnissen mit einem Flammpunkt unter 21 °C,
- mehr als 5 000 Tonnen Methanol aus anderen Stoffen als Mineralöl,
- mehr als 10 000 Tonnen Mineralölprodukte,
die außerdem die Eigenschaft sehr giftig/giftig oder kanzerogen im Sinne der Gefahrstoffverordnung aufweisen, sind die Anforderungen der TA Luft 3.1.8 zu beachten7).
Die Anforderungen der TA Luft 3.1.8 ff sind beispielsweise erfüllt durch die Verwendung von Flanschen mit Nut und Feder oder Vor- und Rücksprung oder durch die Verwendung besonderer Dichtungen, wie metallarmierte oder kammprofilierte Dichtungen.
8.5 Rohrbegleitheizungen
(1) Heizeinrichtungen müssen so betrieben werden, dass von ihnen keine gefährlichen Betriebszustände ausgehen können. Dazu ist eine Temperaturregelung und eine Temperaturbegrenzung erforderlich.
(2) Die Einhaltung der Anforderungen ist vor der ersten Inbetriebnahme zu dokumentieren.
9 Vermeidung gefährlicher elektrischer Ausgleichsströme
9.1 Allgemeines
(1) Rohrleitungen und mit ihnen in leitender Verbindung stehende Anlagenteile müssen so errichtet sein, dass sie gegen Erde keine elektrischen Potentialunterschiede aufbauen können, die zur Entstehung zündfähiger Funken oder gefährlicher Korrosionen oder zur Gefährdung von Personen führen.
(2) Für die betrieblichen Anforderungen an den kathodischen Korrosionsschutz gilt TRbF 20 Anhang O Nummer 6 Ziffer 1.
(3) Anschluss-, Verbindungs- und Trennstellen in Erdungsleitungen müssen gegen unbeabsichtigtes Lockern gesichert sein. Trennstellen müssen leicht zugänglich und möglichst oberirdisch angeordnet sein.
(4) Bei Anwendung des kathodischen Korrosionsschutzes ist, falls in die Rohrleitung Isolierstücke eingebaut sind, die Ableitung der Aufladungen von den leitfähigen Teilen auf andere Weise als durch direkte Erdung sicherzustellen. Dies kann durch den Innenwiderstand der benutzten Schutzstromquelle (Schutzstromgerät oder galvanische Anode) sichergestellt werden.
9.2 Erdung
(1) Rohrleitungen und mit ihnen in leitender Verbindung stehende Anlagenteile dürfen nicht allein als Erder für elektrische Anlagen verwendet werden.
(2) Anlagenteile dürfen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse elektrisch getrennt oder in die Erdungsmaßnahmen der Gesamtanlage einbezogen werden.
9.3 Vermeidung gefährlicher Korrosionen
Für die Erdungsanlagen sind solche Metalle zu verwenden, die gefährliche Korrosionen an Rohrleitungen nicht befürchten lassen. Beispielhaft
5
) Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Bd. 13(1983) Nr. 1, S. 346
) Herausgeber: DECHEMA e.V., Frankfurt/Main7
) Auf die jeweils gültige Fassung der TA Luft wird verwiesen.
ist diese Forderung als erfüllt anzusehen, wenn bei Rohrleitungen aus Stahl die
Erdungsleitungen aus verzinktem oder zur Erhöhung der Lebensdauer aus
zinnverbleitem Bandstahl oder bei oberirdischer Verlegung auch aus
Kupferleitungen (Kupferseil 50 mm², keine Außenisolierungen) hergestellt sind
und beim Anschluss der Erdungsleitung an der Rohrleitung Elementbildungen
vermieden werden.
9.4 Streuströme
(1) Rohrleitungen und andere Anlagenteile müssen gegen Zünd- und Korrosionsgefahren durch Streuströme elektrischer Anlagen gesichert sein. Dabei sind sowohl die zur Rohrleitungsanlage gehörenden elektrischen Anlagen als auch fremde elektrische Anlagen, z.B. elektrische Bahnen, zu berücksichtigen.
(2) In den Bereichen, in denen mit Streuströmen elektrischer Anlagen zu rechnen ist, z.B. bei Gleisanlagen und längeren Rohrleitungen sowie bei Parallelführung von Hochspannungsfreileitungen, muss vor einem Trennen der Rohrleitung die Trennstelle metallenleitend überbrückt sein.
(3) Können Rohrleitungen als Sammler von Fremdströmen wirken, sind je nach Lage des Einzelfalles Isoliermaßnahmen (z.B. Einbau von Isolierstücken) vorzunehmen.
10 Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladung
(1) Rohrleitungen und andere Anlagenteile müssen gegen elektrostatische Aufladungen, die zu gefährlichen Entladungsvorgängen führen können, gesichert sein.
(2) In Zone 0 müssen zündfähige Entladungen auch unter Berücksichtigung selten auftretender Betriebsstörungen ausgeschlossen sein.
(3) In Zone 1 dürfen zündfähige Entladungen bei sachgemäßem Betrieb der Anlagen, einschließlich Wartung und Reinigung, und bei Betriebsstörungen, mit denen üblicherweise gerechnet werden muss, nicht zu erwarten sein.
(4) In Zone 2 sind Maßnahmen in der Regel nur erforderlich, wenn zündfähige Entladungen ständig auftreten.
(5) Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn die berufsgenossenschaftliche Regel für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen BGR 1328) beachtet ist. Insbesondere ist zu beachten, dass
- durch Erdungsmaßnahmen nur die Ansammlung zündfähiger Ladungen auf den leitfähigen Anlagenteilen oder in leitfähigen Flüssigkeiten verhindert nicht aber die Aufladung der nicht leitfähigen brennbaren Flüssigkeiten oder der nicht leitfähigen Anlagenteile vermieden werden kann,
- metallische Bauteile in explosionsgefährdeten Bereichen elektrostatisch leitfähig miteinander verbunden sein müssen. Bei einer verschraubten Flanschverbindung mit einer nichtmetallischen, elektrostatisch nicht leitfähigen Dichtung gilt dies beispielsweise auch dann als erfüllt, wenn die metallischen Kontaktflächen der Flansche und Schrauben mit einem Schutzanstrich versehen sind,
- in der Regel mit dem Erdboden in Berührung stehende metallische Rohrleitungen, auch wenn sie mit Bitumen oder Asphalt gegen Korrosion geschützt sind, ausreichend elektrostatisch geerdet sind. Nur wenn ihr Ableitwiderstand gegen Erde größer als 106 Ohm ist, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um einen Ableitwiderstand von weniger als 106 Ohm zu gewährleisten.
(6) Auch beim Befördern von brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III in Rohrleitungen, die aufgrund der vorhergehenden Beförderung explosionsfähige Atmosphäre enthalten können, sind Maßnahmen für die Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen erforderlich.
11 Blitzschutz
(1) Werden Rohrleitungen in explosionsgefährdeten Bereichen durch Isolierstücke getrennt, so muss gewährleistet sein, dass es bei einem objektfernen Blitzeinschlag zu keiner gefährlichen Entzündung explosionsfähiger Atmosphäre kommen kann.
(2) Werden gasführende Rohrleitungen und Rohrleitungen, die nicht ständig mit Flüssigkeit gefüllt sind, durch Isolierstücke getrennt, sind geeignete Blitzschutzmaßnahmen erforderlich, die Überschläge innerhalb der Rohrleitungen (Zone 0) verhindern oder die Auswirkungen auf ein ungefährliches Maß beschränken. Dazu zählen z.B. Funkenstrecken außerhalb der Rohrleitungen, spezielle Isolierflansche, übergeordnete Blitzschutzmaßnahmen oder ergänzende Explosionsschutzmaßnahmen wie der Einbau von Flammendurchschlagsicherungen.
(3) Bestehende Anlagen sind nachzurüsten9)
8
) zu beziehen bei Carl-Heymanns-Verlag, Köln9
) Nachrüstfrist bis 31.12.200310
) Mitteilungen des DIBt Heft 6/2000 S. 206ffFunkenstrecken, die in einer die Rohrleitung umgebenden Zone 1 oder Zone 2 angeordnet sind, brauchen nicht explosionsgeschützt ausgeführt zu werden.
12 Brandschutz
(1) Für oberirdische Rohrleitungen im Freien sind Art und Ausführung der Brandschutzeinrichtungen in Abhängigkeit von den möglichen
Brandgefahren in Abstimmung mit der für den Brandschutz zuständigen Stelle festzulegen.
(2) Für oberirdische Rohrleitungen in Gebäuden ist die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen10) zu beachten.
13 Gebote, Verbote, Kennzeichnung und Bestandspläne
(1) Die Abfassung der Gebots- und Verbotshinweise und die Art ihrer Bekanntgabe sind den betrieblichen Verhältnissen anzupassen.
(2) Oberirdisch verlegte Rohrleitungen müssen gut sichtbar und in ausreichender Häufigkeit durch Farbanstrich oder Beschriftung gekennzeichnet sein, wenn Leitungen mit unterschiedlichen gefährlichen Stoffen verlegt sind und wenn eine eindeutige Zuordnung zu einer Anlage nicht möglich ist. Auf DIN 2403 wird hingewiesen.
(3) Der Verlauf unterirdisch verlegter Rohrleitungen muss in Rohrleitungsplänen erfasst sein. Kreuzungsstellen mit und Näherungsstellen zu anderen Energieleitungstrassen sind in den Rohrleitungsplänen zu kennzeichnen.
14 Betriebsanweisung, Betriebsvorschriften 14.1 Allgemeine Betriebsvorschriften
(1) Wer eine Rohrleitung für brennbare Flüssigkeiten betreibt, hat diese in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, ordnungsgemäß zu betreiben, ständig zu überwachen, notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten unverzüglich vorzunehmen und die den Umständen nach erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.
(2) Eine Rohrleitung darf nicht betrieben werden, wenn sie Mängel aufweist, durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden können. Es sind unverzüglich Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung des gefährlichen Zustandes zu ergreifen.
(3) Flucht- und Rettungswege müssen freigehalten werden.
(4) Zum Mischen oder Fördern brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen A 1, A Il oder B unter Verwendung von Druckgas dürfen brennbare oder die Verbrennung unterhaltende Gase nicht verwendet werden.
14.2 Allgemeine Betriebsanweisung, Unterweisung der Beschäftigten, Benutzen von Sicherheits- und Brandschutzeinrichtungen
(1) Der Betreiber ist verpflichtet, den Inhalt der im Betrieb anzuwendenden Vorschriften dieser Verordnung in einer für den Beschäftigten verständlichen Form und Sprache in einer Betriebsanweisung darzustellen und sie an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen oder auszuhängen.
(2) Die Beschäftigten müssen über die auftretenden Gefahren sowie über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor der Beschäftigung und danach in angemessenen Zeitabständen, mindestens einmal jährlich, unterwiesen werden.
(3) Der Betreiber ist verpflichtet, die zur Abwendung von Gefahren erforderlichen Weisungen zu erteilen, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und für die Beachtung solcher Weisungen zu sorgen.
(4) Die im Gefahrenbereich der Rohrleitung Beschäftigten haben die an sie gerichteten Weisungen zu befolgen.
(5) Die zur Abwendung von Gefahren erforderlichen Weisungen und die bei Schadensfällen zu ergreifenden Maßnahmen sind Bestandteil der Betriebsanweisungen.
(6) Sicherheits- und Brandschutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen
oder ganz oder teilweise unwirksam gemacht werden. Sie müssen so betrieben, gewartet und unterhalten werden, dass ihre Wirksamkeit erhalten bleibt.
14.3 Ständige Überwachung
(1) Eine Rohrleitung kann als ständig überwacht angesehen werden, wenn sie
1. durch Personal beaufsichtigt wird oder
2. durch technische Einrichtungen entsprechend gesichert ist.
(2) Art und Umfang der Überwachung nach Absatz 1 richten sich nach den Erfordernissen des Einzelfalls.
14.4 Beauftragung von Fachbetrieben
(1) Der Betreiber ist verpflichtet, mit der Montage, Installation, Instandhaltung, Instandsetzung oder Reinigung der Anlagen oder Anlagenteile nur solche Fachbetriebe zu beauftragen, die über die notwendigen Geräte und Ausrüstungsteile für eine gefahrlose Durchführung der Arbeiten und über das erforderliche Fachpersonal verfügen.
(2) Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn ein entsprechender Fachbetrieb nach § 19 1 WHG beauftragt wird. Für Arbeiten an Anlagen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A II oder B muss der Fachbetrieb zusätzlich über die erforderlichen Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes verfügen. Die Überwachung der Fachbetriebe für Anlagen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A 11 oder B wird durch die Sachverständigen nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 im Geltungsbereich ihrer amtlichen Anerkennung nach der VbF durchgeführt. Fachbetriebe für Anlagen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A II oder B müssen einmal jährlich überwacht werden. Fachbetriebe des Betreibers einer Anlage für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A I, A II oder B sowie Fachbetriebe für Anlagen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III müssen zweijährlich überwacht werden.
(3) Die Beauftragung eines Fachbetriebes nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn die Arbeiten von Einheiten des Betreibers, welche die Anforderungen von Absatz 1 erfüllen, an eigenen Anlagen durchgeführt werden. Die Einheiten des Betreibers werden für Arbeiten an eigenen Anlagen Fachbetrieben gleichgestellt.
14.5 Koordinierung der Arbeiten
(1) Vergibt ein Betreiber (Auftraggeber) Arbeiten an andere Unternehmer, hat er, soweit dies zur Vermeidung einer möglichen gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, die alle Arbeiten aufeinander abstimmt.
(2) Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass diese Person insoweit Weisungsbefugnis gegenüber seinen Auftragnehmern und deren Beschäftigten hat.
(3) Übernimmt ein Unternehmer Aufträge, deren Durchführung zeitlich und örtlich mit Aufträgen anderer Unternehmer zusammenfällt, ist er zusätzlich verpflichtet, sich mit den anderen Unternehmen abzustimmen, soweit dies zur Vermeidung einer gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist.
(4) Zur Durchführung der Abstimmung nach Absatz 1 und 3 ist mindestens erforderlich, dass Art und Umfang der Arbeiten rechtzeitig vor Beginn allen betroffenen Unternehmern angezeigt werden.
15 Reinigen, Instandhalten und Instandsetzen
15.1 Allgemeines
(1) Arbeiten zum Reinigen. Instandhalten und Instandsetzen von Rohrleitungen dürfen nur durchgeführt werden (siehe hierzu Nummer 15.4), wenn die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen sind. Die Schutzmaßnahmen hat der Betreiber unter Berücksichtigung der Eigenschaften der brennbaren Flüssigkeiten und der dadurch bedingten Gefahren, der Arbeitsverhältnisse und der Schutz und Rettungsmaßnahmen anzuordnen und die Beschäftigten darüber zu unterrichten:
(2) Der Betreiber hat eine zuverlässige, mit den Arbeiten, den dabei auftretenden Gefahren und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertraute Person als Aufsichtführenden (Verantwortlichen) zu beauftragen und diesen erforderlichenfalls durch Bereitstellung von Sachkundigen und Geräten zu unterstützen. Der Aufsichtführende hat insbesondere dafür zu sorgen, dass
1. mit den Arbeiten erst begonnen wird, wenn die festgelegten Maßnahmen getroffen sind,
2. die festgelegten Maßnahmen während der Arbeiten eingehalten werden,
3. die Beschäftigten während der Arbeiten die vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstungen benutzen,
4. die Beschäftigten im Notfall ausreichende Fluchtmöglichkeiten haben,
5. Unbefugte von der Arbeitsstelle ferngehalten werden.
15.2 Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen
(1) In explosionsgefährdeten Bereichen sind Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich, wenn bei den durchzuführenden Arbeiten zur Reinigung, Instandhaltung und Instandsetzung gefährliche explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist, sich bilden kann oder (z.B. durch Nachvergasung) erneut bilden kann. Für die in den einzelnen Zonen notwendigen Schutzmaßnahmen gilt Nummer 6.5.1.
(2) Stehen Räume, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, mit anderen Räumen vorübergehend in offener Verbindung, so ist im Einzelfall festzulegen, welcher Bereich um die Verbindungsöffnung als explosionsgefährdet gilt. Dies gilt auch für ins Freie führende Öffnungen. Stehen Räume, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, vorübergehend in offener Verbindung zu darunter liegenden Räumen, gelten diese in der Regel als explosionsgefährdet.
(3) Arbeiten in Zone 0 sind zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, dürfen die Arbeiten nur von besonders eingewiesenen Personen und nur mit Betriebsmitteln, Werkzeugen und persönlichen Schutzausrüstungen, die für Zone 0 zulässig sind, durchgeführt werden.
(4) Zu den Arbeiten, die in Zone 0 nicht vermieden werden können, gehören z.B. kurzfristige Inspektionsarbeiten in nicht völlig entleerten oder ungereinigten Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten.
(5) Sollen innerhalb oder oberhalb von explosionsgefährdeten Bereichen Arbeiten zur Reinigung, Instandhaltung und Instandsetzung vorgenommen werden, so hat der Betreiber der Anlage oder sein Beauftragter die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen anzuordnen und ihre Durchführung sicherzustellen.
(6) In den explosionsgefährdeten Bereichen dürfen Arbeiten zur Reinigung, Instandhaltung und Instandsetzung, die zündfähige Funken erzeugen können, nicht durchgeführt werden. Funken mit größerer Zündfähigkeit erhält man bereits mit leichten Schlägen von beliebigem Material auf rostigen Stahl, wenn an der Schlagstelle Spuren von Aluminium oder Magnesium vorhanden sind.
(7) Für Arbeiten mit Zündquellen (z.B. Feuer- oder Schleifarbeiten) wird auf Nummer 15.3 verwiesen. Zu diesen Arbeiten gehören auch
1. Schweißarbeiten an den begrenzenden Wänden,
2. Arbeiten mit Zündgefahr neben oder über Öffnungen von Räumen, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann.
15.3 Zeitlich begrenzte Aufhebung von explosionsgefährdeten Bereichen
(1) Bei Bau- oder Reparaturarbeiten dürfen Zündquellen wie offene Flammen oder Funken verwendet werden bzw. auftreten, wenn der für die Ausführung der Arbeiten Verantwortliche nach entsprechender Prüfung schriftlich erklärt, dass und ggf. unter welchen Voraussetzungen dies unbedenklich ist, und wenn die in der Erklärung angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind.
(2) Sollen innerhalb von Zone l Fahrzeuge normaler Bauart verkehren, so hat der Betreiber der Rohrleitung oder sein Beauftragter für die Zeit des Verkehrs dafür zu sorgen, dass im Verkehrsbereich keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist oder dorthin gelangen kann; er hat die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen anzuordnen und ihre Durchführung sicherzustellen.
15.4 Ableitung von Dampf/Luft-Gemischen bei Arbeiten an Anlagen zur Beförderung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen AI,AII und B
(1) Bei Arbeiten zur Reinigung, Instandhaltung und Instandsetzung an Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A I, A II und B sind Dampf/Luft-Gemische gefahrlos abzuleiten. Auf TRbF 20 Nummer 9.1 wird verwiesen.
(2) Beim Ableiten ins Freie können sich insbesondere im Bereich des Austritts der Dampf/Luft-Gemische von brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklasse A 1, A II und B über die für den Normalfall festgelegten explosionsgefährdeten Bereiche hinaus weitere explosionsgefährdete Bereiche ergeben.
(3) In engen Höfen und in ähnlicher geschlossener Bebauung sind die aus Rohrleitungen austretenden Dampf/Luft-Gemische so abzuführen (z.B. an eine andere Stelle außerhalb der Höfe) oder zu verdünnen (z.B. durch Injektorwirkung), dass hier keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann.
(4) Beim Ableiten der Dampf/Luft-Gemische ins Freie werden insbesondere Weisungen im Einzelfall entsprechend Nummer 14.2 erforderlich, z.B. Einschränkung des Fahrzeugbetriebes, Stillsetzen elektrischer und sonstiger nicht-explosionsgeschützter Anlagen, Verhindern des Eindringens von Dampf/Luft-Gemischen in Kanäle, Schächte und andere benachbarte und tiefer gelegene Räume.
15.5 Geerdete Anlagen und Anlagen mit kathodischem Korrosionsschutz zur Beförderung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A II und B
(1) Vor der Trennung geerdeter Anlagenteile muss eine leitfähige Überbrückung hergestellt werden. Auf Nummer 9 bis 11 wird verwiesen.
(2) Sind Anlagen zur Beförderung brennbarer Flüssigkeiten mit einer kathodischen Korrosionsschutzanlage ausgerüstet, müssen in explosionsgefährdeten Bereichen bei Arbeiten, die zu einer Unterbrechung des Schutzstromes führen können, Schutzmaßnahmen zur Vermeidung zündfähiger Funken getroffen werden.
(3) Bei kathodischen Korrosionsschutzanlagen, die mit Fremdstrom betrieben werden, ist eine rechtzeitige Abschaltung der Stromquelle erforderlich, weil unter ungünstigen Umständen noch über längere Zeit Restspannungen bestehen bleiben können.
15.6 Wiederherstellen des ordnungsgemäßen Zustandes nach Abschluss der
Arbeiten
(1) Nach Abschluss der Arbeiten zum Reinigen, Instandhalten, Instandsetzen und Prüfen müssen die Anlagen wieder in ihren ordnungsgemäßen Zustand versetzt werden.
(2) Insbesondere sind Sicherheitseinrichtungen wieder in funktionsfähigen Zustand zu versetzen, Anlagenteile, die zur Durchführung der Arbeiten getrennt wurden, einander richtig zugeordnet wieder fachgerecht und dicht zu verbinden und Öffnungen wieder dicht zu verschließen, ggf. unter Verwendung neuer Dichtungen.
(3) Die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Anlage ist vom Fachbetrieb zu bescheinigen. Die Bescheinigung entfällt in den Fällen von Nummer 14.4 Absatz 3.
16 Außerbetriebsetzen und Stilllegen
(1) Rohrleitungen, die außer Betrieb gesetzt werden, sind so zu sichern, dass Gefahren für Beschäftigte und Dritte nicht entstehen. Freie Rohrleitungsenden müssen dicht verschlossen sein; dies gilt nicht für Lüftungsleitungen.
(2) Rohrleitungen, die vorübergehend außer Betrieb gesetzt werden, sind vollständig zu entleeren und so zu reinigen, dass sowohl explosionsfähige Atmosphäre in gefahrdrohender Menge nicht mehr vorhanden ist und nicht mehr entstehen kann als auch eine Verunreinigung der Gewässer und des Grundwassers nicht zu besorgen ist: Rohrleitungen sind gegen Benutzung zu sichern. Leckanzeigegeräte sollten in Betrieb bleiben. Kathodische Korrosionsschutzanlagen müssen in Betrieb bleiben.
(3) Bleibt eine Rohrleitung nach ihrer endgültigen Außerbetriebnahme im Erdreich liegen, sind die Ausrüstungsteile zu demontieren. Rohrleitungen sind beidseitig abzutrennen und zu verschließen.
17 Kontrollen durch den Betreiber
Der Betreiber einer Rohrleitung kontrolliert in den erforderlichen zeitlichen Abständen unter Berücksichtigung der Betriebsanweisungen nach Nummer 14, ob sich die Rohrleitung in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet.
Er achtet insbesondere darauf, dass
1. Brandschutzeinrichtungen und Bindemittel für ausgelaufene brennbare Flüssigkeiten in der festgelegten Menge an den dafür bestimmten Stellen in einsatzbereitem Zustand vorhanden sind,
2. ggf. vorhandene Brandmeldeanlagen betriebsbereit sind,
3. keine unzulässigen Stoffe und Gegenstände in explosionsgefährdeten Bereichen vorhanden sind,
4. Rohrleitungen und Armaturen dicht sind,
5. die vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen funktionsfähig sind,
6. Angriffswege für die Brandbekämpfung freigehalten werden und
7. in explosionsgefährdeten Bereichen das Verbot des Rauchens und des Umgangs mit offenem Feuer eingehalten wird.
Anhang zu TRbF 50
Der Anhang A zur TRbF 50 enthält die für Rohrleitungen relevanten Beschaffenheitsanforderungen aus TRbF 131 Teil 1 und 231 Teil 1, die bis zur Ablösung durch entsprechende europäische Normen fortgelten. Die Nummerierungen der TRbF wurden jeweils beibehalten.
Der Anhang B zur TRbF 50 enthält die für Schlauchleitungen relevanten Beschaffenheitsanforderungen aus TRbF 131 Teil 2 sowie die Betriebsanforderungen aus TRbF 131 Teil z. Die Beschaffenheitsanforderungen im Anhang B gelten bis zur Ablösung durch entsprechende europäische Normen fort.
Auf § 4 Absatz 2 VbF (Fassung vom 13. Dezember 1996, BGBl 1 S. 1937 ff) sowie auf die Vorbemerkung zur TRbF 50 wird hingewiesen.
Hinweis: § 12 der VbF vom 27.02.1980 ist durch die Änderung der VbF vom 19.12.1996 gestrichen worden. Für den Explosionsschutz relevante Beschaffenheitsanforderungen an Geräte und Schutzsysteme sind durch die Explosionsschutzverordnung vom 12.12.1996 (BGBl. I, S. 1914) ersetzt worden.
Rohrleitungen, Schutzvorkehrungen und Sicherheitseinrichtungen dürfen nach den wasserrechtlichen Bestimmungen nur verwendet werden, wenn für sie eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung nach § 19h Absatz 1 oder 2 WHG erteilt worden ist oder ein die Eignungsfeststellung/Bauartzulassung ersetzender sonstiger Nachweis nach § 19h Absatz 3 WHG geführt wird.
Anhang A: Für Rohrleitungen relevante Beschaffenheitsanforderungen aus der TRbF 131 Teil 1 und TRbF 231 Teil 1
3.2 Anforderungen an Rohre aus metallischen Werkstoffen
3.21 Werkstoffe
Nummer 3.1 Abs. 1 und 2 gilt als erfüllt, wenn Rohre aus metallischen Werkstoffen nach Ziffer 1 bis 5 verwendet und ihre Güteeigenschaften nach Nummer 3.25 nachgewiesen werden. Alternativ können Rohre nach TRR 100 verwendet werden.
1. Rohre aus unlegierten oder niedriglegierten Stählen
- Rohre nach DIN 1626,
- Rohre nach DIN 1629,
- Rohre nach DIN 17 175,
- Rohre nach DIN 17 177,
- Rohre nach DIN EN 10 208-2,
2. Rohre aus nichtrostenden austenitischen Stählen nach DIN 17 457, DIN 17 458 und SEW 400,
3. - Installationsrohre aus Kupfer nach DIN EN 1057 der Sorte SFCu F 22 (in Ringen) nahtlos gezogen mit Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kupferrohre e.V.,
- Rohre aus Kupfer nach DIN EN 12449 bzw. DIN EN 12451 der Sorten SF-Cu F 22 und F 25 entsprechend DIN EN 12 449,
4. für unterirdische Rohrleitungen mit einer Nennweite über DN 25 und für oberirdische Rohrleitungen
- Rohre aus Reinaluminium oder Aluminium-Knetlegierungen nach AD-Merkblatt W 6/1 Tafel 1,
5. Rohre aus sonstigen metallischen Werkstoffen, wenn ihre Eignung vor deren Verwendung durch ein Gutachten des Sachverständigen nach § 16 Abs. 1 der VbF erstmalig nachgewiesen worden ist.
3.23 Berechnung
Für die Berechnung wird auf TRR 100 verwiesen.
3.24 Prüfung der Werkstoffe
(1) Bei Rohrleitungen der Gruppen 1, 2.1, 2.2 und 3 richtet sich der Prüfumfang nach den in Nummer 3.21 genannten Werkstoffnormen bzw. Gütebestimmungen.
(2) Bei Rohrleitungen der Gruppen 2.3 und 4 richtet sich der Prüfumfang nach den AD-Merkblättern der Reihe W
(3) Bei Werkstoffen nach Nummer 3.21 Ziffer 5 richtet sich der Prüfumfang nach dem Gutachten des Sachverständigen.
3.25 Nachweis der Güteeigenschaften
(1) Für Rohrleitungen der Gruppen 2.2 und 3 ist der Nachweis der Güteeigenschaften nach den Anforderungen in den entsprechenden Normen zu erbringen, mindestens jedoch nach DIN EN 10 204 Abschnitt 2.2.
(2) Für Rohrleitungen der Gruppen 2.3 und 4 ist der Nachweis der Güteeigenschaften nach den Anforderungen der AD-Me7rkblätter der Reihe W zu erbringen.
(3) Bei Rohren für Rohrleitungen der Gruppen 1 und 2.1 und Rohrleitungen der Gruppen 2.2 und 3 mit einem Durchmesser bis DN 100 genügt als Gütenachweis die Stempelung mit Werkstoffsorte und Herstellerzeichen bzw. bei Kupferrohren nach DIN EN (057 mit dem Zeichen DIN EN 1057 und dem Gütezeichen.
(4) Der Nachweis der Güteeigenschaften für Rohre nach Nummer 3.21 Ziffer 5
ist entsprechend dem Gutachten des Sachverständigen zu erbringen.
3.3 Anforderungen an Formstücke aus metallischen Werkstoffen
3.31 Werkstoffe
(1) Nummer 3.1 Abs. 1 und 2 gilt als erfüllt, wenn
1. für Formstücke aus Rohren
Werkstoffe nach Nummer 3.21,
2. für Formstücke aus Blechen
Stähle nach AD-Merkblatt W 1, W2 und W6/1 bei unterirdischer
Verlegung beruhigte Stähle,
3. für Formstücke aus Stahlguss und Gusseisen
Werkstoffe nach AD-Merkblatt W 5 bzw. W 3,
4. für Formstücke aus Temperguss
GTW-40 nach DIN EN 1562,
5. für Formstücke nach DIN EN 1254 aus Kupferwerkstoffen (= DN 25, = PN 10) SF-Cu, G-CuSn5ZnPb verwendet werden. Alternativ können Formstücke nach TRR 100 verwendet werden.
(2) Für Formstücke dürfen Gusseisen nach Ziffer 3 und Temperguss nach Ziffer 4 nur für Schraubverbindungen mit einer Nennweite bis DN 100, einem Druck bis PN 16 und einer Temperatur bis 120 °C verwendet werden.
(3) Für Formstücke zwischen Tank und erster Absperreinrichtung (siehe TRbF 20 Nummer 9.4.1) dürfen nur Werkstoffe nach Absatz 1 Ziffer 1 oder 2 oder Stahlguss nach Ziffer 3 verwendet werden.
(4) Für Formstücke aus Werkstoffen nach Absatz 1 Ziffer 1 und 2 und für Formstücke aus Stahlguss nach Absatz L Ziffer 3 gilt die Verarbeitbarkeit und Schweißeignung als nachgewiesen.
3.33 Herstellung
Für die Herstellung von Formstücken gilt Nummer 5 dieser TRbF sinngemäß. Die AD-Merkblätter der Reihe HP sind zu beachten.
3.34 Prüfung
(1) Bei Formstücken für Rohrleitungen der Gruppen 1 und 2.1 richtet sich der Prüfumfang nach den in Nummer 3.31 genannten Werkstoffnormen bzw. Gütebestimmungen. Für die Prüfung von geschweißten Formstücken gelten die AD-Merkblätter der Reihe HP sinngemäß.
(2) Formstücke für Rohrleitungen der Gruppen 2.2, 2.3, 3 und 4 sind nach DIN 2609 unter sinngemäßer Beachtung der AD-Merkblätter der Reihe HP zu prüfen. Auf VdTÜV-Merkblatt 1252 wird hingewiesen.
3.35 Nachweis der Güteeigenschaften
(1) Formstücke für Rohrleitungen der Gruppen 1, 2.1, 2.2 und 3 aus Werkstoffen nach Nummer 3.31 Abs. 1 Ziffer 1 sind vom Herstellerwerk zu prüfen. Über die Prüfung ist ein Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 auszustellen.
(2) Für Formstücke in Rohrleitungen der Gruppen 2.3 und 4 ist der Nachweis der Güteeigenschaften unter sinngemäßer Anwendung der AD-Merkblätter der Reihe W zu erbringen.
(4) Abweichend von Absatz 1 genügt bei Formstücken für Rohrleitungen der Gruppen 1, 2.1, 2.2 und 3 mit einem Durchmesser bis DN 100 als Gütenachweis die Stempelung mit Werkstoffsorte, Nenndruckstufe und Herstellerzeichen. Bei Fittings nach DIN EN 1254 bis DN 25 genügt als Gütenachweis die Stempelung mit der Herstellerkennzeichnung.
3.4 Anforderungen an Armaturen aus metallischen Werkstoffen
(1) Nummer 3.1 gilt für Absperreinrichtungen im Zuge von Rohrleitungen als erfüllt, wenn Gehäuse nach TRB 801 Nummer 45 verwendet werden und wenn die Absperreinrichtungen (Armaturen) hinsichtlich Herstellung, Bemessung, Prüfung und Gütenachweis DIN 3230-5 und -6 entsprechen.
(2) Für Nennweiten bis DN 100, Betriebsüberdrücke bis 10 bar und Temperaturen bis + 50 °C dürfen geeignete Aluminium-Gusslegierungen*11 ) mit einer Bruchdehnung von mindestens 5 % verwendet werden, wenn die Armatur gegenüber den auftretenden Beanspruchungen überdimensioniert ist. Dies ist in der Regel als erfüllt anzusehen, wenn die Armaturen für den nächsthöheren Nenndruck PN 16 ausgelegt sind. Schweißungen an den Armaturen sind nicht zulässig.
(3) Für Armaturen an Rohrleitungen zur Versorgung von Ölfeuerungsanlagen gilt Nummer 3.1 auch als erfüllt, wenn andere metallische Werkstoffe mit ausreichender Zähigkeit verwendet werden, wie z.B. Knetwerkstoffe (Kupferlegierung) nach VdTÜV-Werkstoffblatt 410 oder die nachfolgend genannten Werkstoffe:
11)
z.B. gemäß DIN 1725 Teil 2GK-CuZn 37 Pb (Werkstoff Nr. 2.0340)
G-CuSn 5 ZnPb (Werkstoff Nr. 2.1096)
G-CuSn 10 (Werkstoff Nr. 2.1050)
CuZn 40 Mn (Werkstoff Nr. 2.0572)
Für die Cu-Werkstoffe sind die nachstehenden Einsatzgrenzen zu beachten:
Nennweite, DN ≤ 65 ≤ 40 ≤ 25 ≤ 15
Betriebsüberdruck, bar ≤ 10 ≤ 20 ≤ 32 ≤ 40Öltemperatur, °C
≤ 120 ≤ 120 ≤ 140 ≤ 140
Auf DIN EN 12514-1 Teil 1 und 2 und auf DIN EN 264 wird hingewiesen. (4) Nach TRbF 20 Nummer 9.4.1 Abs. 2 und 3 geforderte Absperreinrichtungen
(erste Absperreinrichtung am Tank) müssen aus Werkstoffen nach TRbF 20 Anlage B
Nr. 5.61 bestehen. Anhang B: Schlauchleitungen Dieser Anhang nennt die für Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und
Beförderung brennbarer Flüssigkeiten aller Gefahrklassen erforderlichen
relevanten Beschaffenheitsanforderungen an Schlauchleitungen sowie die
erforderlichen Betriebsvorschriften, die für die Installation und Montage, den
Betrieb sowie der Wartung von Schlauchleitungen zu beachten sind. Es gelten die Anforderungen der TRbF 131 Teil 2 "Schlauchleitungen"
in der Fassung der Bekanntmachung vom B. Juni 1992 (BArbBl. 7-8/ 1992 S. 72). Die TRbF 131 Teil 2 ist eine bei der EG-Kommission notifizierte Technische
Regel, die Beschaffenheitsanforderungen enthält. Diese TRbF wird nicht mehr
aktualisiert.
| Anfang |